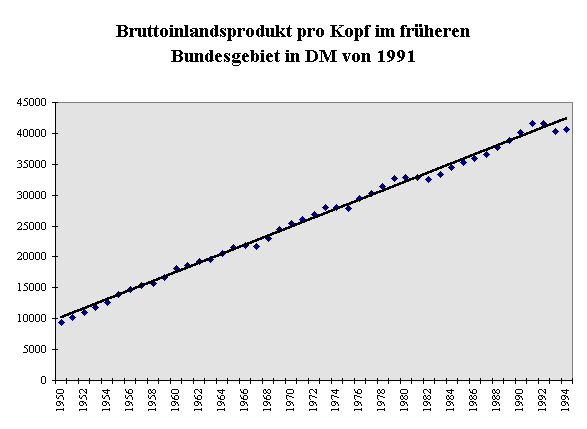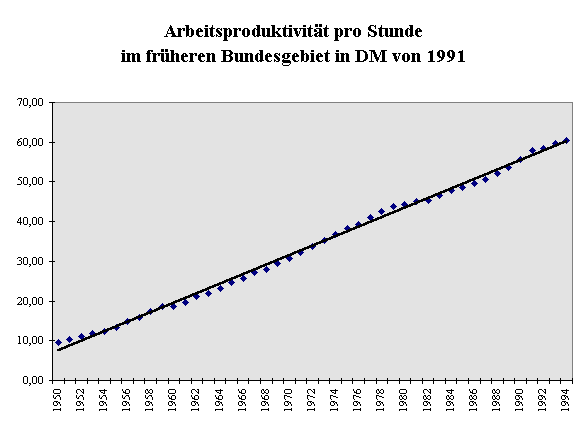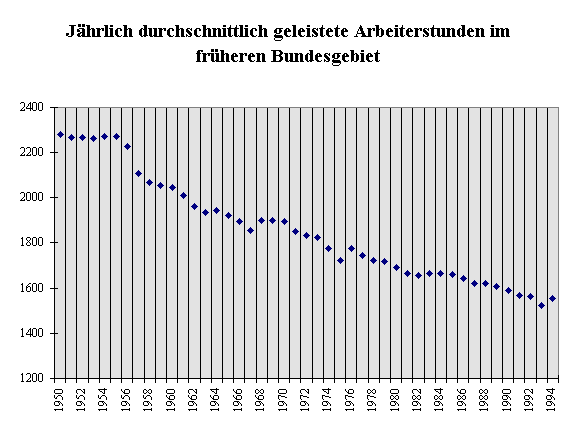Zukunftsverbrauch
Probleme intergenerationaler Verteilung und sozialer Gerechtigkeit[1]
Urs Müller-Plantenberg
„Das Grundgesetz ist ein gutes Gesetz.
Lies es laut, wenn es in der Leitung knackt!“
Dieses genial kurze und scheinbar zeitlose Gedicht von Stefan Gant[2] aus den sechziger Jahren erweist sich bei näherer Betrachtung nicht nur als durch den großen Lauschangriff gleich in doppelter Weise überholt, weil das Grundgesetz erstens nun nicht mehr so gut ist und weil zweitens die Wanzen keine Leitung mehr brauchen, in der es knacken könnte. Die Qualität der Verfassung wird aber in den letzten Jahren auch grundsätzlich von einem Teil der Gesellschaft bezweifelt, der sich darin nicht wiederfinden kann, von der Jugend. In Artikel 3 heißt es zwar, daß vor dem Gesetz alle Menschen gleich seien und niemand „wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“ dürfe, von der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Generationen wird aber in diesem Zusammenhang nicht gesprochen. Dabei wird die direkte und indirekte Benachteiligung und Diskriminierung der am Ende dieses Jahrhunderts heranwachsenden Generation immer skandalöser, selbst wenn ein Teil dieser Generation das ganze Ausmaß des Skandals nicht wahrnehmen will.[3]
Immerhin hielten bei einer am 6. März 1998 veröffentlichten Umfrage von ntv-emnid 67 Prozent der jüngeren Befragten (bis zu 29 Jahren) die soziale Sicherung in Deutschland für sich persönlich nicht für ausreichend, während die Befragten mit 60 und mehr Jahren zu zwei Dritteln die soziale Sicherung als ausreichend empfanden.
Die Alterssicherung ist für die Alten da
Ganz offenbar beginnen die jüngeren Leute zu ahnen, daß mit ihrer Zukunft etwas nicht stimmt. Und sie haben recht. Beginnen wir mit einer Betrachtung des Systems der Alterssicherung:
Die auf Existenzsicherung zielende Rentenversicherung, bei der in einem Umlageverfahren Jahr für Jahr die (abhängig) „arbeitende“ Generation mit ihren Beiträgen den Lebensabend der aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Alten finanziert, ist keineswegs, wie viele meinen, das Werk Otto von Bismarcks. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Altersrenten für die meisten Rentnerinnen und Rentner ein Zubrot, ein Taschengeld. Zum größeren Teil war die Versorgung der Alten nach wie vor Aufgabe der Familien. Erst die 1957 eingeleitete Rentenreform hat mit der Einführung der am Wirtschaftswachstum orientierten „dynamischen“ Rente ein Niveau angezielt, das es den Alten möglich machen sollte, ohne Rückgriff auf die Einkünfte ihrer Nachkommen zu leben.
Diese erhebliche Steigerung des Rentenniveaus bei gleichzeitiger Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten bedeutete natürlich, daß in den ersten Jahren danach eine ganze Generation von Rentnerinnen und Rentnern in den Genuß einer relativ hohen Rente kamen, für die sie selbst entweder gar keinen oder jedenfalls einen wesentlich geringeren Beitrag eingezahlt hatten. Die abhängig arbeitende Bevölkerung hatte dafür - im Bonner Staat natürlich mit Ausnahme der Beamten - eine real auf weit mehr als das Doppelte steigende Belastung durch Beiträge zur Rentenversicherung zu tragen.
Pfennigfuchser könnten schon hier eine Art intergenerationaler Verteilungsungerechtigkeit entdecken. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch bei dieser massiven Umstellung um nichts anderes als um die Ablösung eines innerfamiliären "Generationenvertrags" durch einen gesellschaftlichen "Generationenvertrag". Die arbeitenden Menschen kauften sich mit ihren plötzlich stark gestiegenen Versicherungsbeiträgen gewissermaßen von der Verpflichtung frei, für das Auskommen der Alten in ihren Familien sorgen zu müssen. Versüßt wurde ihnen dieser Freikauf dadurch, daß die Kapitalseite für die Hälfte der Versicherungsbeiträge aufzukommen hat, was bis heute zu den Klagen dieser Seite über die hohen Lohnnebenkosten beiträgt.
Die gesellschaftlichen Folgen dieser innerfamiliären Entsolidarisierung zugunsten des gesellschaftlich vermittelten Vertrages zwischen den Generationen sind gar nicht zu unterschätzen. Mit der „Entsorgung“ der Großeltern setzte sich nämlich in der „Eltern“-Generation zunehmend auch die Erkenntnis durch, daß man selbst im Alter nicht mehr auf die eigenen Kinder angewiesen sein werde; und damit eröffnete sich die bis dahin ungeahnte Möglichkeit, auch ohne die qualvollen Mühen der Aufzucht eigener Nachkommen ein Leben mit Aussicht auf einen auskömmlichen Ruhestand zu führen.
Die Rentenreform von 1956 hat also die Aufgabenteilung zwischen den Generationen grundsätzlich verändert, indem sie die Alterslasten sozialisiert hat, gleichzeitig aber die Lasten der Aufzucht von Kindern als Privatangelegenheit den Familien überlassen hat. Der Generationenvertrag wird seither als eine Angelegenheit behandelt, die nur zwischen den Generationen der Aktiven und der Alten auszuhandeln ist, während vorher die Generation der Kinder unbedingt dazugehörte.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis nach 1956 eine neue Generation den Aspekt der innerfamiliären Alterssicherung völlig aus dem Auge verlor und von der neuen Freiheit Gebrauch machen sollte, das Reproduktionsverhalten ganz nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Ab 1964 nahm die Geburtenrate dramatisch ab und sank bis 1986 auf die Hälfte, während die durchschnittliche Lebenserwartung im gleichen Zeitraum noch um etwa sechs Jahre stieg. Die materiellen Kosten und der Zeitaufwand für die Aufzucht der Kinder wurden von einem wachsenden Teil der damals jüngeren Generation als zu hoch empfunden; und da die Altersversorgung nun von staatlicher Seite ausreichend gesichert schien, blieben die Nachfahren aus, die für das dauerhafte und nachhaltige Funktionieren des Systems der Altersrenten auch in der nächsten Generation hätten sorgen können. Stattdessen wuchs allmählich eine sorglos unbeschwerte Schicht von sogenannten „Singles“ und „Dinks“ („double income, no kids“) heran, die in nichts an die „Junggesellen, Jungfern ohne Ehestellen“ des vorigen Jahrhunderts erinnern, von denen Wilhelm Busch böse nur zu sagen wußte, sie pflanzten „sich durch Knollen fort“.
Die Jugendsicherung war dem Alten zu teuer
Hier ist es angemessen, eine längere Passage aus den Entscheidungsgründen anzuführen, die das Bundesverfassungsgericht zu seinem vernichtenden Urteil vom 7. Juli 1992 über das bisherige System der Alterssicherung bewogen haben, weil sich präziser kaum ausdrücken läßt, worum es geht. Es heißt dort:
„Das bestehende Alterssicherungssystem führt zu einer Benachteiligung von Personen, die sich innerhalb der Familie der Kindererziehung widmen, gegenüber kinderlosen Pcrsonen, die durchgängig einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Zwar macht das Rentenrecht keinen Unterschied zwischen Personen mit und ohne Familie. Rentenleistungen werden unabhängig vom familiären Status allein an die vorherige Beitragszahlung aus dem Arbeitslohn geknüpft. Diese bestimmt den Rentenanspruch. Auf die Gründe, die zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und infolgedessen zum Ausfall von Beitragszahlungen führen, kommt es nicht an. Rentenrechtlich werden Personen, die wegen Kindererziehung aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wie jeder andere nicht Erwerbstätige behandelt.
Im Unterschied zu den Gründen, die sonst für die Erwerbslosigkeit und damit den Ausfall von Beitragszahlungen ursächlich sein mögen, hat die Kindererziehung allerdings bestandssichernde Bedeutung für das System der Altersversorgung. Denn die als Generationenvertrag ausgestaltete Rentenversicherung läßt sich ohne die nachrückende Generation nicht aufrechterhalten. Diese bringt die Mittel für die Alterssicherung der jetzt erwerbstätigen Generation auf. Ohne nachrückende Generation hätte sie zwar Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt, könnte aber keine Leistung aus der Rentenversicherung erwarten. Dabei kann angesichts der Breitenwirkung der Rentenversicherung vernachlässigt werden, daß nicht jedes Kind später zum Beitragszahler wird.
Die bisherige Ausgestaltung der Rentenversicherung führt im Ergebnis zu einer Benachteiligung der Familie, namentlich der Familie mit mehreren Kindern. Die Familie, in der ein Elternteil zugunsten der Kindererziehung aus dem Erwerbsleben ausscheidet, nimmt im Vergleich zu Kinderlosen nicht nur Einkommenseinbußen hin, sie muß das gesunkene Einkommen vielmehr auch auf mehrere Köpfe verteilen. Wenn die Kinder in das Erwerbsleben eingetreten sind und durch ihre Beiträge die Alterssicherung der Elterngeneration mittragen, haben die Eltern selbst eine geringere Rente zu erwarten.“ (Zitiert nach Borchert 1993, S. 312).
In der Diskussion über die Ursachen des Geburtenrückgangs seit den sechziger Jahren wird häufig ausgeführt, daß der Anteil des Faktors Alterssicherungssystem an der Erklärung dieses Phänomens nicht zu quantifizieren sei. Der Wandel kultureller Grundmuster, die steigende Erwerbsneigung emanzipierter Frauen, die erstmalige Verfügung über wirksame Verhütungsmittel und viele andere Faktoren spielten ebenfalls eine erhebliche Rolle. Es geht aber hier gar nicht um die genaue Quantifizierung der Rolle der einzelnen Faktoren; es geht darum, daß die meisten Menschen vor der Einrichtung der existenzsichernden Altersversorgung sich einen Wandel ihrer kulturellen Grundmuster oder eine dauerhaft wirkende Verhütung gar nicht leisten konnten. Sie brauchten Kinder, um für ihr Alter vorzusorgen. Heute braucht die Gesellschaft Kinder zur Bestandssicherung des Systems der Altersversorgung; die Einzelne oder der Einzelne braucht keine Kinder, für ihre Alterssicherung können die Kinder der anderen sorgen.
In der Entwicklungsländerforschung ist es im übrigen selbstverständlich, den Mangel an Systemen sozialer Sicherheit als wesentlichen Faktor für die hohe Kinderzahl und das noch immer schnelle Bevölkerungswachstum verantwortlich zu machen (vgl. Hein 1998, S. 56).
Das Bundesverfassungsgericht hat sein Urteil 1992 vor allem darauf ausgerichtet, die Diskriminierung der Eltern gegenüber den Kinderlosen als ungerecht und deshalb nicht der Verfassung entsprechend zu kritisieren. Und der Sozialrichter Jürgen Borchert, der als Urheber der Verfassungsbeschwerde und Prozeßbevollmächtigter dieses Urteil hat durchsetzen können, hat in seinem Buch „Renten vor dem Absturz. Ist der Sozialstaat am Ende?“ ebenfalls die mangelnde Berücksichtigung der Kindererziehung im Rentenrecht in den Vordergrund gestellt. Er hat darauf hinweisen können, daß Wilfrid Schreiber, der Erfinder der Formel der „dynamischen“ Rente und eigentliche Schöpfer der Rentenreform, 1956 durchaus die Notwendigkeit einer doppelten Generationensolidarität - nämlich zwischen Alten und Aktiven und zwischen Aktiven und Nachwachsenden - gesehen und deshalb als Ergänzung zur Altersrente eine „Jugendrente“ vorgesehen hatte, die als anderes Standbein das System auf Dauer im Gleichgewicht hätte halten können. „Wer kinderlos oder kinderarm ins Rentenalter geht,“ schrieb der kinderlose Schreiber damals, „und, mit dem Pathos des Selbstgerechten, für gleiche Beitragsleistungen gleiche Rente verlangt und erhält, zehrt im Grunde parasitär an den Mehrleistungen der Kinderreichen, die seine Minderleistungen kompensiert haben. Es gibt, allen Spöttern zum Trotz, ein gesellschaftliches ‘Soll’ der Kinderzahl ..., damit die Gesellschaft am Leben bleibt und auch für den Unterhalt ihrer Alten aufkommen kann. ... Es ist nicht mehr als billig und gerecht, daß der wirtschaftliche Dienst, den der Kinderreiche der Gesellschaft leistet und der Kinderarme ihr schuldig bleibt, auch in den wirtschaftlichen Parametern der Rentenordnung seinen Niederschlag findet.“
Die Jugendrente fiel dem politischen Kalkül des Bundeskanzlers Konrad Adenauer zum Opfer. Sie hätte nach Schreibers Konzept eine Beitragsbelastung des Bruttoeinkommens der Erwerbstätigen in Höhe von etwa acht Prozent erfordert, was zu der gleichzeitigen Erhöhung des Beitragssatzes für die Altersversicherung von elf auf 14 Prozent hinzugekommen wäre. Adenauer wußte, daß die Alten - im Unterschied zu den Kinderreichen - in der Wählerschaft einen großen und wachsenden Anteil darstellen, während Kinder und Jugendliche überhaupt nicht wählen dürfen, und verzichtete auf die Jugendrente. 1957 erhielten die Unionsparteien CDU und CSU die absolute Mehrheit.
Die Renten sind sicher - für die Rentner von heute
Daß die Nachhaltigkeit[4] eines solchen Systems sozialer Sicherung von Anfang an gefährdet sein mußte, ist mit aller Deutlichkeit erst in den letzten Jahren erkannt worden, dann aber vor allem als Ausdruck und Ergebnis der sogenannten „demographischen Falle“ verstanden worden, in die die Rentenversicherung geraten sei. Damit ist gemeint, daß immer weniger Aktive für immer mehr Alte zu zahlen haben. Dieser Wandel, der in den siebziger und achtziger Jahren noch langsam vonstatten ging und vor allem der Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung zu verdanken war, beschleunigt sich seither dadurch, daß die sehr starken Vorkriegsjahrgänge allmählich ins Rentenalter kommen und die sehr schwachen Jahrgänge aus der Zeit nach 1975 ins Erwerbsalter nachrücken. Der Wandel wird sich nach 2010 noch einmal erheblich beschleunigen, wenn die ebenfalls sehr starken Jahrgänge der fünfziger Jahre das Rentenalter erreichen und gleichzeitig noch schwächer besetzte Jahrgänge nachrücken. Die heute vorliegenden Daten lassen die Prognose zu, daß in dreißig Jahren von den dann Erwerbstätigen pro Kopf doppelt so viele Rentnerinnen und Rentner versorgt werden müssen wie heute.
Das geltende Umlageverfahren der Altersrentenversicherung läuft also zwangsläufig darauf hinaus, daß in den nächsten Jahrzehnten - bei welcher vorstellbaren Wachstumsrate auch immer - entweder die Beitragszahlungen erheblich steigen oder die staatlich garantierten Rentenansprüche stark fallen müssen. Eher wahrscheinlich ist, daß beides passiert. Die Jugendlichen von heute haben also recht, wenn sie dem System mißtrauen, insbesondere wenn sie von der Regierung zu hören bekommen, daß die Renten „für die heutigen Rentner“ sicher sind. Für wen denn nicht, fragen sie sich dann.
Von den aktiven Erwerbstätigen wird also, wie das in einer alternden Gesellschaft kaum anders zu denken ist, mit jedem Jahr mehr eine steigende Generationensolidarität abverlangt. Die einzige Hoffnung, die sie in dieser Hinsicht haben können, ist, daß diese Solidarität vorhält, solange sie noch leben.
Da in dem geltenden System im Prinzip Jahr für Jahr soviel an die Rentnerinnen und Rentner abgegeben wird, wie von den Beitragszahlenden eingezahlt wird, erscheint das Problem, ob eher die Beiträge erhöht oder die Renten gekürzt werden, als ein jeweils aktuelles Verteilungsproblem zwischen den Generationen.
„Intergenerationale Verteilungsgerechtigkeit“
Eine andere Betrachtungsweise ergibt sich, wenn man für jede Generation - oder genauer: für jeden Jahrgang und am besten auch nach Frauen und Männern getrennt - ausrechnet, wie das Verhältnis zwischen den lebenslang eingezahlten Beiträgen und den im Alter ausgezahlten Renten sich finanziell darstellt. So etwas wie „intergenerationale Verteilungsgerechtigkeit“ würde sich dann einstellen, wenn nicht jeder Einzelne, wohl aber alle Jahrgänge darauf rechnen könnten, im Prinzip pro Beitragseinheit am Ende genausoviel herauszubekommen wie die Jahrgänge vor und nach ihnen.
Es liegt auf der Hand, daß dieser Maßstab der „intergenerationalen Verteilungsgerechtigkeit“ ein Maßstab ist, der dem Gedanken der Versicherungsmathematik und der Kosten-Nutzen-Rechnung stärker verpflichtet ist als dem Gedanken der Solidarität, zumal die Berechnungen nur angestellt werden können, wenn eine Vielzahl von Annahmen über eine ganze Reihe von Variablen - vom Reproduktionsverhalten bis zu den Zinssätzen - gemacht werden müssen. Und es ist daher kein Wunder, daß entsprechende Berechnungen vor allem von Ökonomen angestellt worden sind und weiter angestellt werden (vgl. Raffelhüschen 1994 oder Börsch-Supan 1997), die sich von neoliberalen Gedanken leiten lassen und einer Umstellung der Rentenversicherung auf ein Kapitaldeckungsverfahren nach chilenischem Muster das Wort reden.
Gleichwohl ist es nicht verkehrt, solche Berechnungen zur Kenntnis zu nehmen, um nämlich zu wissen, wie stark die einzelnen Generationen beziehungsweise Jahrgänge in ihrem gesamten Lebenslauf durch die Ausgestaltung des Systems der sozialen Sicherung belastet werden oder profitieren, und damit abschätzen zu können, ob nicht für eine Generation der Gedanke der Solidarität so zu ihrem Schaden überstrapaziert wird, daß sie sich mit Recht gegen diese Zumutung zur Wehr setzen muß.
Und in der Tat sind die Ergebnisse solcher Untersuchungen dramatisch zu nennen. Der Freiburger Ökonom Bernd Raffelhüschen kommt zu dem Schluß, daß „die Regierung die heutigen Alten von der Verantwortung für künftige Generationen vollständig ausnimmt und die Lasten alleine den heutigen Jungen aufbürdet.“ (Zitiert nach DIE ZEIT vom 7. November 1997).
Nicht nur der ersten Generation von Alten nach Einführung der dynamischen Rente ist wesentlich mehr ausgezahlt worden, als sie je eingezahlt hat, auch bei den Jahrgängen bis etwa 1950 wird es so sein, daß sie - bei Annahme eines realistischen Zinssatzes - davon ausgehen können, daß sie während des Restes ihres Lebens durchschnittlich mehr werden einnehmen können, als sie insgesamt einbezahlt haben.[5] Die Zunahme der Lebenszeitbelastung setzt dann mit voller Wucht bei den Jahrgängen nach 1965 ein.
Die Ungerechtigkeit, von der vorher die Rede war, daß nämlich Menschen - und vor allem Frauen -, die sich der Kindererziehung gewidmet haben oder wegen Arbeitslosigkeit und Teilzeitarbeit nicht die Karriere eines männlichen Dauer-Vollzeit-Normalarbeiters erreichen konnten, kommt in diesen Berechnungen nicht vor, weil die sich ja ausdrücklich auf das Verhältnis von tatsächlich gezahlten Beiträgen zu tatsächlichen Rentenzahlungen beziehen, und da haben die Mütter, Arbeitslosen, Teilzeitbeschäftigten usw. eben sowieso Pech gehabt.[6]
Ein Grund für die Besserstellung der heutigen älteren Generation wird von den neoliberalen Kritikern auch darin gesehen, daß im geltenden System Anreize vorhanden sind, die sich ökonomisch nicht rechtfertigen lassen, gleichwohl aber ihre Wirkung haben. So wurde und wird beispielsweise die Möglichkeit des vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand ohne Kürzung der Rente von vielen Älteren wahrgenommen, obwohl sie eigentlich dem System widerspricht und zu einer einseitigen überproportionalen Erhöhung der persönlichen Rendite auf die Beiträge führt. Wahrscheinlich hat sich nie ein Ruheständler die Erhöhung seiner Rendite ausgerechnet; Tatsache ist aber, daß die Jahrgänge, die seit den siebziger Jahren ins Rentenalter aufgerückt sind, in sehr konsequenter Weise alle Möglichkeiten ausgereizt haben, ihre Rente aufzustocken und vorzuziehen, und das auch, weil sie öffentlich immer dazu aufgefordert worden sind.
Eine von der Volkswirtschaftlichen Forschungsgruppe der Deutschen Bundesbank veröffentlichte Studie zum „Generational Accounting“, in der nicht nur die Rentenversicherung analysiert wird, sondern für die einzelnen Jahrgänge alle Steuern und Beiträge gegen die staatlichen Transfers verrechnet werden (Boll 1996), kommt für die Bundesrepublik zu dem Ergebnis, daß bei einer Fortführung der gegenwärtigen Finanzpolitik (einschließlich des Systems sozialer Sicherung) ein solches „Ungleichgewicht zu Lasten künftig geborener Wirtschaftssubjekte“ mit einem so hohen Lebenszeitsteuersatz für die künftigen Generationen entstünde, daß von einer dauerhaften Tragfähigkeit nicht mehr gesprochen werden könne.
Die Vorstellung, daß sich ein System, das den Transfer von Leistungen von heranwachsenden und zukünftigen Generationen an die heutige Generation der Älteren, also gewissermaßen den vorzeitigen Verbrauch von Zukunft, auf Dauer stellen ließe, ist in der Tat absolut irreal. Wer die von der Situation erzwungenen Korrekturen allesamt im voraus als „Abbau des Sozialstaats“ qualifiziert, gibt sich Illusionen hin, die politisch teuer werden können. Je später solche Korrekturen kommen, desto heftiger und umfassender werden sie nämlich sein müssen. Die heute im Vordergrund stehende Diskussion über die Überlastung der Rentenversicherung durch „versicherungsfremde Leistungen“ wie die Finanzierung eines wesentlichen Beitrags zur Wiedervereinigung Deutschlands oder die Übernahme der Renten der zugewanderten Aussiedlerinnen und Aussiedler ist zwar wegen der Folgen für die Höhe der Lohnnebenkosten eine aktuell wichtige politische Frage, gemessen an dem langfristigen Problem des Verhältnisses zwischen den Generationen aber eher als bedeutungslos anzusehen.
Der Arbeitsmarkt ist für die Arbeitenden da
Die heranwachsende Generation hätte also guten Grund, darüber nachzudenken, ob sie nicht aus einem System aussteigen sollte, das sie strukturell benachteiligt. Großen Teilen dieser Generation wird aber von vornherein keine Möglichkeit gelassen, über das Aussteigen nachzudenken, weil man sie gar nicht erst einsteigen läßt.
Ein Arbeitsmarkt, auf dem die wesentlichen Kämpfe der Beschäftigten darauf gerichtet sind, bestehende Arbeitsplätze für die Arbeitenden zu erhalten, läßt für die, die neu hinzutreten, nur den Platz am kürzeren Hebel. Dabei ist die Sicherung möglichst hoher und vor allem vollständiger Rentenansprüche ein wichtiger Anreiz für die möglichst lange Verteidigung bestehender Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse. Die Auseinandersetzungen über Regelungen für Altersteilzeit machen nur deutlich, wie wichtig die mögliche Ausreizung aller anwendbaren Bestimmungen über die Rentenhöhe für die Attraktivität solcher Regelungen ist.
Auf einem solchen Arbeitsmarkt haben die Hinzukommenden schlechte Karten. Besonders dramatisch ist die Lage im öffentlichen Dienst, wo die unabweisbar notwendigen Sparmaßnahmen auf eine Personalstruktur treffen, in der das relativ gut bezahlte ältere Personal praktisch unkündbar ist, was dazu führt, daß der „Nachwuchs“ entweder überhaupt keine Chance hat oder ziemlich lange warten und dann häufig froh sein muß, halbe Stellen oder Zweidrittel-Stellen zu besetzen, die nur lächerlich geringe Rentenansprüche in ferner Zukunft begründen (Vgl. auch Schömann 1995 sowie Ganßmann und McArthur 1995).[7]
Die - gemessen an der gesamten Erwerbsbevölkerung - hohe Zahl der jungen Leute, die entweder arbeitslos sind oder sich - zum Teil gegen ihren Willen - gerade in der Lebensphase der Familiengründung (oder wenigstens des Kinderkriegens) mit schlecht bezahlten Teilzeitbeschäftigungen begnügen müssen, wird zwar wegen der geringen Rentenansprüche, die auf diese Weise erworben werden, nach einigen Jahrzehnten für eine Entlastung der Rentenversicherung sorgen; das ist aber für die jungen Leute nicht mal ein schwacher, sondern gar kein Trost, weil sie es sind, die in der Zwischenzeit die ganze Beitragslast für die voll ausgereizten Renten der Älteren werden tragen müssen.
Als Ausweg wird den Jugendlichen der Weg in die Selbständigkeit angedient, der die Beteiligung an der staatlich organisierten Rentenversicherung unnötig macht. Die große Masse der in den letzten Jahren entstandenen, nicht sozialversicherungspflichtigen selbständigen Existenzen ist aber nicht das Ergebnis unternehmerischen Risikos von Leuten, die sich mühelos ihre Altersversorgung organisieren können, sondern Resultat der Umwandlung von Beschäftigungsverhältnissen in scheinselbständige Tätigkeiten durch Auslagerung bestimmter Handreichungen oder Dienstleistungen aus Firmen oder Behörden. Diese Art von „Outsourcing“ im Kleinen stellt - ebenso wie die Zunahme gering bezahlter Jobs ohne Versicherungspflicht - für die Rentenversicherung eine zusätzliche Belastung dar, weil durch sie die Zahl der Beitragszahlenden noch weiter gesenkt wird.
Entsprechendes gilt natürlich auch und erst recht für den scheinbar genialen Trick der Verbeamtung von Angestellten des öffentlichen Dienstes. Was Kommunen und Betroffene jetzt sparen können, kommt - „nach uns die Sintflut“ - in Jahrzehnten als doppelte und dreifache Belastung auf die öffentliche Hand und die Versicherungsträger zu.
Das Erbe ist für die Erben da
Nun könnte man einwenden, daß - zumindest in einer wachsenden Wirtschaft - die Problematik der Verteilung zwischen den Generationen eine Scheinproblematik sei, weil eines Tages ja doch die von einer Generation angesammelten Reichtümer an die nächste Generation weitervererbt werden. In der Tat haben sich bei den Alten, die in den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrtausends das Zeitliche segnen werden, Werte in einer Höhe angesammelt, wie es sie in der Geschichte Deutschlands noch nie gegeben hat. Die Erben, an die diese Werte weitergegeben werden, werden meistens zunächst noch zu der Generation gehören, die von der intergenerationalen Verteilungswirkung des Systems sozialer Sicherung am meisten profitiert. Selbst wenn diese Erben mit ihrem Erbe sehr verschwenderisch umgingen, würde nach ihrem Ableben immer noch ein immenser Reichtum an die nächste, nun also die durch die Systemkrise benachteiligte Generation weiterwandern und könnte dazu dienen, die hohen Beiträge mitzufinanzieren oder die niedrigen erworbenen Rentenansprüche zu ergänzen.
Diese Rechnung stimmt global, aber sie erweist sich als grundfalsch, wenn man die Vermögenskonzentration in die Betrachtung einbezieht. Der zu vererbende Reichtum ist noch wesentlich weniger gleichmäßig auf die Gesellschaft verteilt als die Rentenansprüche oder die Arbeit. Ein großer Teil dieses angesammelten Vermögens wird an eine sehr kleine Gruppe vererbt, während die Masse der jeweils nachfolgenden Generationen von den Erblassern kaum etwas zu erwarten hat. Und in der Regel sind es gerade die auf Sozialhilfe angewiesenen jungen Leute, die auf ein Erbe überhaupt nicht hoffen können.
Wer den intergenerationalen Transfer durch das System der sozialen Sicherung gegen die Erbschaften aufzurechnen sucht, redet praktisch einer massiven Umverteilung von unten nach oben das Wort. Manche jungen Leute mögen durch eine angenehm hohe Rente mancher Sorgen enthoben werden; eine Lösung der Krise des ganzen Systems kann sich dadurch nicht ergeben. Im Gegenteil wird die Vermögenskonzentration noch dadurch gefördert, daß die Globalisierung als Argument benutzt wird, die Abschaffung der Vermögenssteuer und hohe Freibeträge bei der Kapitalertragssteuer durchzusetzen.
Indem das Steuersystem insgesamt Kinderlose begünstigt und gerade junge Eltern direkt oder indirekt bestraft (vgl. Borchert 1993, S. 186ff.), trägt es ebenfalls zur Vermögenskonzentration bei. Je mehr Kinder Leute haben, desto weniger Chancen haben sie, Reichtum anzuhäufen, den sie ihnen vererben könnten.[8]
Der Verzicht auf eine angemessene Besteuerung des tatsächlich existierenden Reichtums führt zu einer öffentlichen Armut, die über stetig wachsende Schulden des öffentlichen Sektors den Verbrauch von Zukunft zusätzlich fördert, indem die Belastung der Haushalte durch den noch schneller wachsenden Schuldendienst den Gestaltungsspielraum von Politik einengt und schließlich zerstört.[9]
Das Wachstum ist nicht exponentiell
Die Hoffnung, daß sich das System vielleicht doch noch für eine Zeit retten ließe, gründet sich nicht selten auf die Annahme, daß sich durch eine angemessene wirtschaftspolitische Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum erreichen ließe, das zum Abbau der Arbeitslosigkeit und damit zur Ausweitung der Finanzierungsbasis der Rentenversicherung führen könne. Dafür wären allerdings Wachstumsraten erforderlich, wie sie in den letzten Jahrzehnten im Durchschnitt überhaupt nicht mehr erreicht worden sind.
Die Diskussion über die Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme und insbesondere der „dynamischen“ Rente leidet ohnehin darunter, daß Prognosen über das zukünftige Wirtschaftswachstum in der Regel eine feste Zuwachsrate zugrundelegen und damit eine exponentielle Wachstumsrate voraussetzen. Die tatsächliche Entwicklung des Bruttoinlandprodukts in den alten Bundesländern spricht dagegen eine ganz andere Sprache, wie das Schaubild 1 und die folgende Tabelle zeigen.
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung - ausgedrückt in DM von 1991 - wuchs in den letzten 45 Jahren durchschnittlich jährlich nicht um einen bestimmten Prozentsatz, sondern um eine bestimmte Summe, nämlich um 712 DM (von 1991), und das heißt: linear.
Tabelle
Durchschnittliche
jährliche Steigerung des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf
zwischen jeweils zwei Wendepunkten des konjunkturellen Zyklus
im früheren Bundesgebiet in DM von 1991
|
Zeitspanne |
durchschnittliche Steigerung |
|
|
|
von Tief zu Tief |
von Hoch zu Hoch |
|
1950-1958 |
804 |
|
|
1955-1960 |
|
822 |
|
1958-1967 |
666 |
|
|
1960-1973 |
|
769 |
|
1967-1975 |
760 |
|
|
1973-1979 |
|
767 |
|
1975-1982 |
669 |
|
|
1979-1991 |
|
745 |
|
1982-1993 |
700 |
|
Jede Person in Westdeutschland wurde also im Schnitt pro Jahr um diese Summe reicher. Und dieser Durchschnitt ergibt sich ungefähr auch für jede Konjunkturperiode, egal ob vom jeweiligen Tief zum nächsten Tief oder vom jeweiligen Hoch zum nächsten Hoch gerechnet. Einzig und allein in der Restaurationsperiode der fünfziger Jahre lag diese Summe mit über 800 DM (von 1991) geringfügig über dem langfristigen Mittel.
Schaubild 1
Quelle:
Die Daten stützen sich auf Tabellen aus den Jahresgutachten des
Sachverständigenrates von 1973 (Tab. 14 und 20, S. 206 und 217) und von 1997
(Tab. 21 und 34, S. 317 und 339).
Dieses - in Werten und physischer Menge - außerordentlich gleichmäßige Wachstum entsprach Anfang der fünfziger Jahre in Zeiten relativer Armut einer Zuwachsrate von acht Prozent und begründete damit den Mythos vom Wirtschaftswunder, während es zu Beginn der neunziger Jahre bei erheblich gestiegenem Volumen der Produktion nur noch eine Zuwachsrate von etwa 1,7 Prozent ausmacht.
Um die existierende Arbeitslosigkeit auch nur allmählich abzubauen und das System sozialer Sicherung wenigstens für eine Zeit zu stabilisieren, wäre, wie man leicht nachrechnen kann, für einen Zeitraum von zehn Jahren eine Verdoppelung der gegenwärtigen Wachstumsraten und damit langfristig ein Trend erforderlich, wie ihn die ökonomisch so ungeheuer erfolgreiche Bundesrepublik auch in den Zeiten blühender Hochkonjunktur nie erlebt hat, nämlich weit oberhalb des bisherigen Trends. Im übrigen würde der für ein solches - wie überhaupt jedes - Wachstum erforderliche Naturverbrauch durch steigenden Stoff- und Energieumsatz noch einmal auf Kosten der nachwachsenden Generation gehen, indem er eine nachhaltige Entwicklung verhindert und damit ebenfalls dazu beiträgt, den vorzeitigen Verbrauch von Zukunft zu steigern (vgl. Altvater und Mahnkopf 1996, S. 566ff.).
Schaubild 2
Quelle:
Siehe Schaubild 1 und 3. Hier wurde die Annahme zugrundegelegt, daß sich die
durchschnittliche Arbeitszeit aller Beschäftigten langfristig parallel zu der
durchschnittlichen Arbeitszeit der Industriearbeiter geändert hat.
Das Schaubild 2 zeigt, daß sich auch die Arbeitsproduktivität, also das Produkt pro Arbeitsstunde linear und nicht exponentiell entwickelt hat. Die Daten für die einzelnen Jahre schmiegen sich sogar noch enger um die langfristige lineare Trendlinie. Lag die Steigerungsrate der Produktivität in den frühen fünfziger Jahren bei gut zehn Prozent, so ist sie Anfang der neunziger Jahre auf unter zwei Prozent gesunken. Man könnte das den tendenziellen Fall der Produktivitätssteigerungsrate nennen. Die Bewegung dieser „Schlüsselvariable in der ‘Standortdebatte’ der globalen Konkurrenz ebenso wie in der innergesellschaftlichen ‘Verteilungsdebatte’“ (Altvater und Mahnkopf 1996, S. 569) ist offenbar als Ergebnis des Wettbewerbs in der kapitalistischen Gesellschaft außerordentlich stabil und politischen Willensentscheidungen ebensowenig zu unterwerfen wie das Wirtschaftswachstum.
Was geändert werden kann und als Ergebnis bewußter politischer Aktivität - in unterschiedlichen Konjunkturen mit unterschiedlichem Ausgang - auch geändert worden ist, ist die durchschnittliche Arbeitszeit der Beschäftigten.
Schaubild 3
Quelle:
Die Daten stammen aus den Jahresgutachten des Sachverständigenrates von 1973
(Tabelle 34 und 35, S. 244-246) und von 1997 (Tabelle 52 und 53, S. 372-374).
Schaubild 3 zeigt, wie sich die durchschnittliche Jahresarbeitszeit der Arbeiter in der Industrie (Bergbau und verarbeitendes Gewerbe) in Westdeutschland entwickelt hat. Dabei zeigt sich, daß sie in den 15 Jahren der Vollbeschäftigung und deshalb relativ großer gewerkschaftlicher Kampfkraft zwischen 1959 und 1974 um 280 Stunden gesunken ist, in den folgenden 15 Jahren wachsender Arbeitslosigkeit bis 1989 nur noch um 167 Stunden und bis 1994 um weitere 54 Stunden.
Die Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzungen sind naturgemäß umstritten. Nimmt man aber einmal an, die Arbeitszeitverkürzung zwischen 1959 und 1974 hätte sich im gleichen Tempo in den nächsten 20 Jahren weiterführen lassen und jede nicht geleistete Arbeitsstunde wäre bei zusätzlichen Beschäftigten nachgefragt worden, so hätte die Zahl der Erwerbstätigen im Jahre 1994 um 10,8 Prozent höher liegen können, als sie tatsächlich lag. Das ist ein verblüffendes Ergebnis insofern, als die offizielle Quote der offenen Arbeitslosigkeit - ohne ABM-Maßnahmen etc. - 1994 bei 8,3 Prozent lag.
Der Rückgang der Geschwindigkeit der Arbeitszeitverkürzung hat natürlich damit zu tun, daß - wie schon angedeutet - die Kampfkraft der Gewerkschaften in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit geschwächt ist. Es spielt aber auch eine Rolle, daß im individuellen Kampf um einen möglichst hohen Rentenanspruch die „Besitzer“ gut bezahlter Arbeitsplätze[10] mehr Wert auf Geld als auf Freizeit legen. Die Rentenformel wird auf diese Weise noch einmal zur Falle für die „Nicht-Besitzerinnen“ und „Nicht-Besitzer“ von Arbeitsplätzen.
Scheinlösung Einwanderung
Um die demographischen Veränderungen auszugleichen, die dem Rentensystem einerseits großenteils geschuldet sind, andererseits seine Krise ständig verschärfen, wird nicht selten vorgeschlagen, eine massive Einwanderung insbesondere junger Leute aus dem Ausland nicht nur zu dulden, sondern regelrecht zu fördern.
Eine solche Einwanderung verändert zweifellos die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland; und ohne die Leute, die sich in den letzten Jahren in Deutschland um Asyl beworben oder die als Deutsche aus Osteuropa zugewandert sind, wäre das relative Übergewicht der älteren Leute noch größer, als es ohnehin schon ist. Die Zuwandernden treten allerdings vorläufig, solange die Arbeitszeitverkürzung nicht massiv beschleunigt worden ist, auf dem Arbeitsmarkt als zusätzliche Konkurrentinnen und Konkurrenten um die weniger werdenden Arbeitsplätze auf. Außerdem sind es nicht nur junge Leute, die zuwandern, und auch die jungen Leute werden mit der Zeit älter und erreichen irgendwann das Rentenalter. Zu erwarten ist, daß sie, ihrer Altersversorgung scheinbar sicher, ihr Reproduktionsverhalten dem der deutschen Bevölkerung anpassen würden und daß auf diese Weise das Problem eher noch verstärkt würde.
Sollte der Bevölkerungsstand durch Immigration bis zum Jahre 2030 stabil gehalten werden, so müßten jährlich mehr als 250 000 Menschen nach Deutschland zuwandern, insgesamt knapp zehn Millionen. Nach (nur auf Westdeutschland bezogenen) Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes würde das zum Ergebnis haben, daß der Anteil der über 60 Jahre alten Bevölkerung von gegenwärtig ungefähr 23 Prozent auf ungefähr 33 Prozent steigen würde und nicht auf 37 Prozent, wie das ohne Zuwanderung der Fall wäre (vgl. Borchert 1993, S. 99f.).
Wie man sieht, ein relativ geringer Unterschied. Wollte man weitergehen und sogar die gegenwärtige Altersstruktur der deutschen Bevölkerung durch Migration stabilisieren, so bedürfte es einer Zuwanderung in ganz anderen Dimensionen. Dreimal so viele, nämlich ungefähr 800 000 vorwiegend junge Menschen müßten dann jährlich in Deutschland aufgenommen werden. Es liegt auf der Hand, daß eine ständige Einwanderung dieses Ausmaßes die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes und der für die Eingliederung erforderlichen Infrastruktur völlig überfordern würde.
Scheinlösung Kapitaldeckungsverfahren
Die Schwere der zu erwartenden und von den großen Volksparteien heruntergespielten Krise des solidarischen Systems der Altersversorgung und die Unmöglichkeit, ihrer mit einfachen Rezepten Herr zu werden, werden von den neoliberalen Kritikerinnen und Kritikern als einmalige Chance gesehen, dem, was sie ökonomische Vernunft nennen, zum Durchbruch zu verhelfen (vgl. etwa Merklein 1986, Raffelhüschen 1989 und 1994, Börsch-Supan 1997, Frankfurter Institut 1997). Ihrer Meinung nach bleibt gar nichts anderes übrig, als mehr oder weniger schnell auf ein zwar staatlich geordnetes, aber doch privat organisiertes Kapitaldeckungsverfahren umzusteigen, das das Problem der intergenerationalen Verteilungsgerechtigkeit löst, indem es den Gedanken der Solidarität zwischen den Generationen (und auch zwischen Reichen und Armen, Kinderreichen und Kinderlosen etc. innerhalb einer Generation) aufgibt. Die von den „Chicago Boys“, den Wirtschaftspolitikern in Chile unter der Militärdiktatur durchgesetzte Reform des Systems der Alterssicherung gilt als das große und nachzuahmende Beispiel: Nach dem reinen Versicherungsprinzip erhält hier jede Rentnerin und jeder Rentner im Alter das zurück, was private Fonds (unter staatlicher Aufsicht) aus den gezahlten Beiträgen durch profitable Anlage auf den nationalen und internationalen Kapitalmärkten erwirtschaftet haben.[11]
Am geltenden Umlageverfahren wird kritisiert, daß es keinen intertemporalen Belastungsausgleich durch zeitweilige Reservenbildung zuläßt (was es mindestens in Grenzen durchaus könnte und zeitweilig getan hat) und daß es den Bedürfnissen einer Kapitalbildung zur Bedienung einer international wechselnden Nachfrage nach Kapital trotz großer jährlicher Transfersummen nicht nachkommt.
Diese Argumente lassen erkennen, worum es auch und vor allem geht, nämlich um die Möglichkeit privater Gruppen, mit riesigen und wachsenden Summen auf den immer schneller rotierenden internationalen Kapitalmärkten mitzuspielen. Wenn es gut ginge, würde hier ein massiver Kapitalexport stattfinden, aus dessen Erträgen aus aller Welt die deutschen Rentnerinnen und Rentner in aller Seelenruhe den Konsum ihres Lebensabends finanzieren könnten und den man deshalb getrost als eine Art „Rentenimperialismus“ bezeichnen könnte. „Kapital statt Kinder?“, fragt hierzu der Sozialrichter Borchert (1993, S. 130).
Daß eine vollständige Umstellung des Umlageverfahrens auf ein System individueller Kapitaldeckung ebenso attraktiv wie unpraktikabel ist, zeigen allein die Summen, um die es dabei geht. Das Frankfurter Institut der Stiftung Marktwirtschaft und Politik (1997) hat in einem Vorschlag „für eine solide Alterssicherung“ vorgerechnet, daß der erforderliche Deckungsstock für die bereits erworbenen Renten- und Pensionsansprüche „nicht größer sein müßte als 6 Billionen Mark“ (S. 18).[12] Manfred Nitsch (1998) beziffert - wie das Bundesministerium für Arbeit - die Renten- und Pensionsverpflichtungen sogar auf zehn Billionen. Aus dem Vergleich mit dem Börsenwert aller in Deutschland gehandelten Aktien in Höhe von einer Billion oder mit den gesamten Staatsschulden von Bund, Ländern und Gemeinden in Höhe von zwei Billionen wird erst deutlich, auf welche Verfügungsmasse da spekuliert wird. Privaten deutschen Versicherungsanstalten würde endlich ermöglicht, mit den US-amerikanischen und japanischen (und chilenischen) Pensionsfonds gleichzuziehen, die mit ihren spekulativen Portfolio-Investitionen auf dem internationalen Kapitalmarkt eine Krise nach der anderen provozieren.
Und was nun?
Allein die Größe des erforderlichen Deckungsstocks dürfte eine Umstellung auf das Kapitaldeckungsverfahren in großem Stil unmöglich machen, wobei natürlich die individuelle Altersvorsorge als privater Zusatz zum öffentlichen System immer möglich war und bleibt. Diese Größe des erforderlichen Deckungsstocks ist deshalb im Kern nicht beliebig variabel, weil die erworbenen Rentenansprüche in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1985 als durch „Eigenleistung“ finanzierte Renten unter den Schutz der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes (Artikel 14) gestellt worden sind. Diese Entscheidung, die durch das oben erwähnte Urteil von 1992 nur in Grenzen relativiert wurde und jede gründliche Rentenreform erheblich erschwert, erweist sich heute als ein schwerer Fehler. Sie wird dem Grundgedanken des Umlageverfahrens, nämlich der Generationensolidarität, nicht gerecht, macht aus der Tatsache, daß die Höhe der jeweiligen Rente (im Vergleich zu den Angehörigen der eigenen Generation) „beitragsbezogen“ sein soll, einen Rechtsanspruch gegenüber der folgenden Generation auf eine entsprechende Auszahlung des Eigentums und schreibt so alles fest, was es an intergenerationaler Verteilungsungerechtigkeit gibt.
Ohne eine weitere offene oder stillschweigende Relativierung dieser staatlichen Eigentumsgarantie für alle Renten wird es keine Lösung geben, die dem Gebot der Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen Genüge tun kann. Früher oder später werden trotz aller heutigen Versprechungen Rentenansprüche gekürzt werden müssen, und zwar je später, desto heftiger. Dabei ist es keineswegs zwingend, daß davon alle Renten in gleicher Weise betroffen sein müßten. Es ist mit dem Prinzip der Generationensolidarität durchaus vereinbar, daß Renten, die zur Existenzsicherung - wegen anderer Einnahmen der Rentnerinnen und Rentner oder auch wegen ihrer Höhe - nicht erforderlich sind, gekürzt werden können.
Es ist hier nicht der Ort, konkrete Vorschläge für die Rentenreform zu machen. Wohl aber läßt sich angeben, wo noch Reserven sind, die es unter grundsätzlicher Beibehaltung des Umlageverfahrens möglich machen, daß das Prinzip der Generationensolidarität und das Gebot der intergenerationalen Gerechtigkeit nicht im selben Ausmaß wie bisher einander entgegenwirken. Zu solchen Reserven würden gehören:
- die Einführung einer steuerfinanzierten Grundrente,
- die Ausdehnung des Systems auf die gesamte Bevölkerung einschließlich der Selbständigen und Beamten (und Abgeordneten),
- die stärkere Berücksichtigung von Zeiten der Kindererziehung, aber auch von Teilzeitarbeit, Aus- und Weiterbildung etc.,
- die Aufnahme einer demographischen Komponente in die Rentenformel, um die Lasten aus der Veränderung der Altersstruktur wenigstens etwas gleichmäßiger zwischen Alten und Aktiven zu verteilen.
Wegen ihrer Auswirkungen auf die relativen Preise für Energie und Arbeit und damit auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes müßte auch die Einführung der sogenannten Ökosteuer zum Zwecke der Teilfinanzierung der Sozialversicherung positive Auswirkungen auf die soziale und die intergenerationale Gerechtigkeit haben.
Alle diese Punkte sind Gegenstand der politischen Debatte. Aber es geschieht nichts. Die Jugend kann nicht mehr lange warten.
Zusammenfassung: Die Gnade der frühen Geburt
Stellen wir uns einen Menschen vor, der 1938 geboren ist, in Westdeutschland zum Mann heranwuchs, zum Wissenschaftler wurde und sich eher als politisch links einordnen würde. Stellen wir uns weiter vor, ihm würde noch einmal die Chance geboten, sich ein Leben auszusuchen, er müßte sich allerdings auf einen Unterschied einlassen: Entweder würde er - immer ceteris paribus - als Frau geboren oder in Ostdeutschland aufwachsen oder als Arbeiter sein Brot verdienen oder zur politischen Rechten finden oder erst 1968 geboren werden. Wir müßten ihm dringend raten, unbedingt auf seiner Geburt im Jahre 1938 zu bestehen, - es sei denn, er wäre vorsichtig in der Wahl seiner Eltern gewesen und könnte sich auf ein üppiges Erbe gefaßt machen. Dann, aber auch nur dann könnte er sich auch leisten, jung zu sein.
Für Beamte gilt das natürlich alles nicht so. Aber wieviele Beamte vom Jahrgang 1968 wird es noch geben?
Literatur:
Elmar Altvater und Birgit Mahnkopf (1996), Grenzen der Globalisierung, Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft, Münster
Stephan Boll (1996): Intergenerative Verteilungseffekte öffentlicher Haushalte - Theoretische Konzepte und empirischer Befund für die Bundesrepublik Deutschland, Volkswirtschaftliche Forschungsgruppe der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main
Jürgen Borchert (1993), Renten vor dem Absturz. Ist der Sozialstaat am Ende?, Frankfurt am Main
Axel Börsch-Supan (1997), Sozialpolitik, in: Axel Börsch-Supan und andere (Hrsg.), Springers Handbuch der Volkswirtschaftslehre, Band 2, Berlin
Christel Eckart (1997), Wechsel als Kontinuität. Ausstiege aus dem Hamsterrad von Leistung und Konkurrenz, in: Kommune, Heft 12
Frankfurter Institut - Stiftung Marktwirtschaft und Politik (Hrsg.) (1997), Rentenkrise. Und wie wir sie meistern können, Bad Homburg
Heiner Ganßmann und Grover McArthur (1995): Arbeitslosigkeit und Einkommensverteilung, in: Prokla 99
Wolfgang Hein (1998), Unterentwicklung - Krise der Peripherie, Opladen
Dörthe Jung (1997), Nachhaltiger Sozialstaat. Frauen als Pionierinnen neuer sozialer Umverteilung und gesellschaftlicher Solidarität, in: Kommune, Heft 3
Renate Merklein (1986), Die Rentenkrise, Hamburg
Urs Müller-Plantenberg (1997), Zur politischen Ökonomie und politischen Soziologie des Lassens, in: Kommune, Heft 7
Manfred Nitsch (1998), Dimensionen von Sozialversicherungsreformen - Lateinamerika, Deutschland und darüber hinaus, in: Lateinamerika - Analysen, Daten, Dokumentation 36
Bernd Raffelhüschen (1989), Anreizwirkungen des Systems der sozialen Alterssicherung. Eine dynamische Simulationsanalyse, Frankfurt
Bernd Raffelhüschen (1994), Social Security and Intergenerational Redistribution: A Generational Accounting Perspective, in: Public Choice 1/2
Klaus Schömann (1995): Zur Dynamik der alters- und geschlechtsspezifischen Verteilung der Arbeitseinkommen, in: Prokla 99
Heidi Schüller (1995): Die Alterslüge, Rowohlt, Reinbek
Heidi Schüller (1997): Wir Zukunftsdiebe, Rowohlt, Reinbek